Der unbekannte Stelzhamer
Artikelserie von Heinz Forstinger
..
-
Folge 16, erschienen im wortgarten, Ausgabe Winter 2013:
Thema der Folge 15 dieser Serie war der dichterische Bezug Franz Stelzhamers zum Whisky. Seine Liebe gehörte aber dem Bier, das er nicht ungern genoss, wohl manches Mal auch zu viel. Doch wer hat da nicht schon gesündigt, besonders in jungen Jahren. Diese Folge soll also durch Stelzhamer dem Bier gewidmet sein. Und wo sollte er zu diesem Stoff praktischer angeregt worden sein als in München, der inoffiziellen Bierhauptstadt Bayerns? Dorthin war er 1851 gezogen; er hoffte, in der ehemaligen Heimat der Innviertler (bis 1779 gehörte dieses Viertel ja zu Bayern) mehr Erfolg mit seinen Büchern zu haben als in Österreich. Doch er irrte. Nachdem er die Verantwortlichen im Cotta’schen Verlag düpiert hatte, half auch eine förmliche Entschuldigung bei Baron von Cotta nicht.
Zu Jahresbeginn 1852 zog seine Frau Betty, nach dem Tod des Töchterchens, zu ihm nach München. Da die Verlage nicht gewillt waren, seine neueren Werke herauszugeben, ging er daran, dies im Selbstverlag zu besorgen. Das konnte nicht gut gehen. Das so gut wie kaum verkaufte „Bunte Buch“, 1852 herausgegeben, wurde zum Großteil Makulatur und blieb daher unbekannt. Auch ein zweiter Versuch im Jahr 1853 scheiterte. Er hatte gedacht, das Thema Bier würde in München ankommen. Doch er hoffte vergebens, zu schwach und zu simpel waren viele Texte.
Was bei Stelzhamer nicht aus dem Herzen kommt, wirkt oberflächlich und konstruiert. Dieses Buch „Gambrinus – Humoristisches Münchener Taschenbuch für das Sudjahr 1853/54“ war ein Konglomerat unterschiedlichsten Inhalts. In der Vorrede weist er entschuldigend darauf hin, dass er als „Fremder“ so ein Büchlein verfasst und dass es sich von seinen bisherigen poetischen Werken durch Bezug zum Alltäglichen und Praktischen abhebt.
Humorvolles präsentiert er im „ Kleinen Gambrinischen Zeitzeiger“, zum Beispiel: „Der Neujahrstag ist beweglich und fällt, wann jedesmal einer der großen Münchener Bierbräuer zum erstenmal seine Pfanne geheizt hat.“ Das Buch enthält auch eine biographische Skizze vom Bierbrauer Joseph Pschorr, dem Begründer der heute noch bekannten Biermarke, die aber längst von einem internationalen Konzern hergestellt wird.
Natürlich ist er auch auf die Salvator- und Bocksaison und das „kgl. Hofbrauhaus“ eingegangen. In „Humoristischen Exercitien“ schreibt er über „Das Trinken“ und „Der Rausch und seine Verwandtschaft“. Ein sechzehn Strophen langes Gedicht heißt „Das Lied vom Rausch“. Eine Strophe daraus als Kostprobe: „Allain bei der Nacht is’s gar gfährli zun Gehen, und drum trink dar a Räuschl, aft seids enka Zwen.“ Ein Märchen „Anima-Digestio“ darf nicht fehlen. Dann folgen kurze Anekdoten um ein Münchner Faktotum, einen gewissen „Vater Krenkel“, Pferdehändler seines Zeichens. Weitere „ Anekdoten, Räthsel u. Schnurren“ schließen sich an, allesamt etwas schlicht. Eine Probe daraus: „Welche schreckliche Krankheit ist den Wirten zu wünschen? Die Wasserscheu.“ Oder: „Warum trinken die Schullehrer so gern und so viel Bier? …weil sie von so saurem Brode leben müssen.“
Dreizehn Seiten beschließen dieses Büchlein, auf denen alle „Brauereien, Bierwirthe, Tafernwirthe und Caféwirthe“, die am 16. August 1853 betrieben wurden, in tabellarischer Form aufgelistet sind. Die erste Seite davon ist hier abgebildet.
-
-
-
Folge 15, erschienen im wortgarten, Ausgabe Herbst 2013:
 Was hat Franz Stelzhamer mit Whisky zu tun? Getrunken hat er ihn wohl selten, er war als Innviertler mehr dem Bier zugetan, aber dichterisch hat er sich ihm genähert. Vom schottischen Nationalpoeten Robert Burns (1759 – 1796), übrigens der Verfasser des Textes zu dem weltweit bekannten Lied „Auld Lang Syne“, gibt es ein eigenartiges Gedicht mit dem Titel „John Barleycorn“, das in kryptischer Form dem Gerstenkorn, der Basis des Whiskys, ein Denkmal setzt. Er hat es 1782 verfasst. Ins Deutsche übersetzt hat es wohl den Weg zu Franz Stelzhamer gefunden, der wiederum daranging, es in oberösterreichische Mundart zu übertragen. Den Titel hat er in direkter Übersetzung als „Hans Gerstenkern“ übernommen. Zum Inhalt bei Burns: Drei Könige beschließen, das Gerstenkorn zu vernichten. (Vielleicht sollte das Gedicht auf den hoffnungslosen Kampf gegen den Alkohol hinweisen.) Die erste Strophe lautet im Original so:
Was hat Franz Stelzhamer mit Whisky zu tun? Getrunken hat er ihn wohl selten, er war als Innviertler mehr dem Bier zugetan, aber dichterisch hat er sich ihm genähert. Vom schottischen Nationalpoeten Robert Burns (1759 – 1796), übrigens der Verfasser des Textes zu dem weltweit bekannten Lied „Auld Lang Syne“, gibt es ein eigenartiges Gedicht mit dem Titel „John Barleycorn“, das in kryptischer Form dem Gerstenkorn, der Basis des Whiskys, ein Denkmal setzt. Er hat es 1782 verfasst. Ins Deutsche übersetzt hat es wohl den Weg zu Franz Stelzhamer gefunden, der wiederum daranging, es in oberösterreichische Mundart zu übertragen. Den Titel hat er in direkter Übersetzung als „Hans Gerstenkern“ übernommen. Zum Inhalt bei Burns: Drei Könige beschließen, das Gerstenkorn zu vernichten. (Vielleicht sollte das Gedicht auf den hoffnungslosen Kampf gegen den Alkohol hinweisen.) Die erste Strophe lautet im Original so:
There was tree kings into the east,
Three kings both great and high,
And they hae sworn a solemn oath
John Barleycorn should die.
In der Folge werden das Mähen, das Dreschen und das Zermahlen des Korns geschildert. Doch es hilft alles nicht, auch das Vergraben in der Erde nicht, es steht immer wieder auf. Nach der Resignation gegen Ende des Gedichtes anerkennen die Könige die stimmungshebende Wirkung durch das „Blut“ des Gerstenkorns und hoffen, dass es in Schottland nie daran fehlen solle. Hier die zwei letzten Strophen:
´Twill make a man forget his woe;
´Twill heighten all his joy;
´Twill make the widow´s heart to sing,
Tho´ the tear were in her eye.
Then let us toast John Barleycorn,
Each man a glass in hand;
And may his great posterity
Ne’er fail in old Scotland!
Nun zur Übertragung durch Franz Stelzhamer. Bei ihm klingt es so:
Drei Zeigahanser Baurn –
So rechte Holzknöpf drei!
Schwörn: Mit Hans Gerstenkern
Wars aus und vorbei!
Olls Wehlaid vogißt man,
Wirst da Störkst und da Schenst,
Sogar d‘ Widing wird lachat,
Dö just nu had drenzt.
Drum Hans Gerstenkern hoch!
Und höbts Glas olle z’gleich,
Daß a dableibt bon üns
In liebn Obröstareich.
Ja, auch das ist unser Franz Stelzhamer!
-
Folge 14, erschienen in der Stelzhamerbund-Zeitschrift wortgarten, Sommer 2013:
Wie gewinnt man die Frauen? Durch Sturmangriff, durch Belagerung oder durch Finten? Weder noch! Das rät Johann Wolfgang von Goethe:
Der Erfahrene
Geh den Weibern zart entgegen,
du gewinnst sie, auf mein Wort.
Und wer rasch ist und verwegen,
kommt vielleicht noch besser fort.
Doch wem wenig dran gelegen
scheinet, ob er reizt und rührt,
der beleidigt, der verführt.“
 Was Goethe in sieben Reimzeilen zusammenfasst, beschreibt Franz Stelzhamer in einer märchenhaften Erzählung von 169 Seiten. Er nennt sie „Sabine“, abgedruckt ist sie im Band II des „Heimgarten“, der 1847 im Verlag von Gustav Heckenast erschien.
Was Goethe in sieben Reimzeilen zusammenfasst, beschreibt Franz Stelzhamer in einer märchenhaften Erzählung von 169 Seiten. Er nennt sie „Sabine“, abgedruckt ist sie im Band II des „Heimgarten“, der 1847 im Verlag von Gustav Heckenast erschien.
Der Ort der Handlung ist ein einsames, gut geführtes Heidewirtshaus. Die Wirtsleute erfreuen sich an ihrer bildhübschen, 16-jährigen Tochter Sabine. Fünf herumreisende Jünglinge aus bestem Hause kehren ein und nehmen Quartier. Jeder ist vom Charakter her anders und mit besonderen Talenten ausgestattet. Bruno ist geistvoll, redegewandt und Führer der Gruppe, Zeno hat Schauspiel- und Tanztalent, Beno weiß mit Stift und Pinsel umzugehen, Euchari-Coelestin wiederum ist begnadeter Lautenspieler, und der letzte, Zenobius, ist ein ruhiger, gedankenschwerer Bursche. Sie feiern fröhliche Tage, doch plötzlich fehlt Zenobius.
Die vier anderen, in Liebe zu Sabine entbrannt, hecken einen Plan aus. Stelzhamer lässt sie sagen: „Ich meinte, wir sollten in wechselseitiger Folge unsere Werbung beginnen…“ Sie einigen sich, dass jedem dafür eine Woche Zeit gewährt werden solle.
Beno trifft das Los, den Reigen zu beginnen. Als Maler gewohnt, die Natur zu betrachten, zeigt er Sabine viele kleine Schönheiten. „Hüpfend und frohlockend kam Sabinchen von jedem Spaziergange nach Hause…“
Nach einer Woche kommt Zeno an die Reihe. Er unterhält und erfreut das Mädchen mit seinen lustigen Einfällen. Dazu Stelzhamer: „Ich kann und will aber Zeno’s Witzspiele und Gaukeleien den Tag über nicht weiter an- und ausführen…“ Ist die Wirkung auf Sabine mäßig?
Der Lautenschläger Cölestinus kommt als nächster an die Reihe. Er versucht mit lieblichen Klängen die holde Maid zu betören. Hören wir Sabine: „..so war’t Ihr’s, der heut in stiller Nacht die wunderlichen Klänge schuf, die auf mich eine ganz besondere Wirkung hatten?“ Warten wir ab, wie er ankommt.
Endlich ist die Reihe an Bruno. Aber seine schönen Worte und seine geistige Überlegenheit sind vielleicht zu viel für das Mädchen. Ihre Worte: „…und dem schwer erforschlichen Cölestin wollte ich eher glauben als Euch, dessen Herz zittern muß vor dem Haselstab der Vernunft.“
Der Vater ist zum Markt gefahren und kommt mit dem verschwundenen Zenobius zurück. Der zeigt ihnen ein vollgeschriebenes Heft: „Flüchtige Bilder aus den Tagen meiner Flucht“. Stehen sehnsuchtsvolle Gedichte darin? Am nächsten Tag hat Sabine Geburtstag, das ist auch der Tag, an dem sich nun alle fünf der Wahl Sabines stellen. Sie soll einen zum Gatten nehmen, das hat der Vater gutgeheißen. Sie soll also einen erhören – jeder hofft. „Sie lächelte Allen und Jedem denselben milden Gruß und Sämmtlich und Jeglich fühlte dasselbe Entzücken“. Damit erhöht Stelzhamer die Spannung. Und so beendet er dieses Märchen:
„Jetzt ist die Geschichte aus, und ich bedaure nur Eins daran, – daß sie kein Anderer geschrieben hat, und viel früher, damit ich sie hätte lesen können, und daß ich nebst dem Plaisir klüger geworden wäre in meinen Liebeshändeln und endlich glücklich, wie Zenobius, der Stillprinz.
Sein Herz enthüllen, klar sich zeigen,
Verehrlich ist’s und wohlgetan;
Doch steht geheimnisvolles Schweigen
Im Liebesspiel hoch obenan.“
-
Folge 13, erschienen in der Stelzhamerbund-Zeitschrift wortgarten, April 2013:
 Unsere Generation hat mit Franz Stelzhamer jedenfalls eines gemeinsam, und auch mit Adalbert Stifter: Wir und sie waren Zeugen einer Sonnenfinsternis, die in Mitteleuropa beobachtbar war. Das Wetter war uns und den Dichtern wohlgesonnen; die astronomische Zufälligkeit der Mondbahn brachte uns und sie zum Staunen. Die Schilderung Stifters von diesem Ereignis, das sich damals am 8. Juli 1842 abgespielt hatte, ist in Buchform erschienen und Belesenen bekannt. Stifter, der Meister der Naturschilderung, lässt das Gesehene in seiner detailreichen Sprache zum Erlebnis werden. Weniger bekannt ist, dass auch Franz Stelzhamer Zeuge dieser Verfinsterung geworden war. Allerdings ist seine Schilderung nur im „Heimgarten“ des Peter Rosegger zu finden und in Vergessenheit geraten. Im Band vom Oktober 1882 ist sie nachzulesen. Während Stifter sich ganz dem Ablauf der Sonnenfinsternis und der Erscheinung an sich widmet, kommen bei Stelzhamer auch die äußeren Umstände und die Empfindungen der Menschen zur Darstellung. Der Titel lautet: „Der 8. Juli 1842. Eine Caprice von Franz Stelzhamer.“ Dass er sich als Naturkundiger und –begeisterter dieses seltene Ereignis nicht entgehen ließ, ist verständlich. Seine Schilderung beginnt so:
Unsere Generation hat mit Franz Stelzhamer jedenfalls eines gemeinsam, und auch mit Adalbert Stifter: Wir und sie waren Zeugen einer Sonnenfinsternis, die in Mitteleuropa beobachtbar war. Das Wetter war uns und den Dichtern wohlgesonnen; die astronomische Zufälligkeit der Mondbahn brachte uns und sie zum Staunen. Die Schilderung Stifters von diesem Ereignis, das sich damals am 8. Juli 1842 abgespielt hatte, ist in Buchform erschienen und Belesenen bekannt. Stifter, der Meister der Naturschilderung, lässt das Gesehene in seiner detailreichen Sprache zum Erlebnis werden. Weniger bekannt ist, dass auch Franz Stelzhamer Zeuge dieser Verfinsterung geworden war. Allerdings ist seine Schilderung nur im „Heimgarten“ des Peter Rosegger zu finden und in Vergessenheit geraten. Im Band vom Oktober 1882 ist sie nachzulesen. Während Stifter sich ganz dem Ablauf der Sonnenfinsternis und der Erscheinung an sich widmet, kommen bei Stelzhamer auch die äußeren Umstände und die Empfindungen der Menschen zur Darstellung. Der Titel lautet: „Der 8. Juli 1842. Eine Caprice von Franz Stelzhamer.“ Dass er sich als Naturkundiger und –begeisterter dieses seltene Ereignis nicht entgehen ließ, ist verständlich. Seine Schilderung beginnt so:
„Ich fuhr auf der Wien-Raaber Eisenbahn. – Das ist nichts! Jeder nur halbwegs honnete Wiener ist bereits darauf gefahren. – Ich saß im prächtigen Salonwagen. – Das ist auch nichts! Viele Bemittelte und jeder Großthuer saßen auch darin…“
Da haben wir ihn wieder, den typischen Franz, der so oft nach dem Sprichwort „Nur der Not keinen Schwung lassen!“ gelebt hat. Die 2. Klasse genügte ihm nicht. In der Station „Meidling“ bestieg er dann wieder den Zug zur Rückfahrt. Lassen wir ihn erzählen:
„Nicht lange, so scholl der bekannte Pfiff des entweichenden Pfnastes – etliche Secunden und der Zug hielt im Gehöfte, um einige harrende Passagiere aufzunehmen. – Nach solchem Hochgenuß am Himmel ist jeder andere auf Erden arm und klein: also eine Karte für den Salonwagen! Sollte ich heute schon Gesellschaft haben, so mußte es die beste, exquisiteste sein! Lieber als schales, triviales Geträtsche anhören, wollt‘ ich mich meiner Privatgedanken und Selbstgefühlen überlassen, so erhaben war meine Stimmung, so selbstzufrieden mein Herz!“
Doch dann beschreibt er drei Mitreisende, ein Geschwisterpaar, sie sechzehn, er zwanzig Jahre alt, und deren etwa fünfzigjährigen Onkel. Der war weitgereist, denn er hatte weltweit schon mehrere Sonnenverfinsterungen beobachtet, wie er den Jugendlichen erzählte. Den Jüngling lässt Stelzhamer dann beschreiben:
„…der fast blutigrothe Wolkenpausch am Leithagebirge hinunter, das pomeranzen- und goldgelbe Nebelgeflatter über Mähren und Böhmen hin, dann das unheimliche, dichte und doch durchsichtige Grau,….wie von Grabeslüften. Der ganzen Natur und aller Creatur stockte auf einige Augenblicke Puls und Athem.“
Auch Stelzhamer weiß treffend zu beschreiben! Leider können wir die Reisenden im Salonwagen nicht weiter begleiten. Jedenfalls beendet der Onkel das Gespräch damit, dass er den Sonnenuntergang im Vergleich mit einem Gewitter, einer Überschwemmung und einem Erdbeben banalisiert, gleichsam „vom Himmel holt“. Stelzhamer zeigt sich somit als der nüchterne, physikalische Betrachter.
-
Folge 12, erschienen in der Stelzhamerbund-Zeitschrift wortgarten, Jänner 2013:
„Was das kindliche Ohr nicht erfasst hat, kann später
nicht mit dem wahren Zungenschlag vorgetragen werden.“
Mit dieser Folge ist das Dutzend voll und ich werde, nachdem Franz Stelzhamer nun endgültig zum Dichter geworden ist, von der biografischen Linie etwas abweichen. Künftig sollen in freier Wahl verschiedene schriftstellerische Arbeiten des Werkes unseres Dichters präsentiert werden. Dabei wird neben eher weniger bekannten Texten seiner Mundartlyrik auch seine hochsprachliche Dichtung Beachtung finden. Ebenso soll in Auszügen auch seine Prosa zum Zuge kommen. Immerhin hat er ja auch auf diesem Feld eine ganze Menge zu bieten.
Den meisten seiner Bücher hat Stelzhamer eine Widmung und auch ein Vorwort vorangestellt. Sein erstes Büchlein, das 1837 bei Peter Rohrmann, k.k. Hofbuchhändler in Wien erschien, hat er mit den Worten „Z’erst mana gueten Mueda, aft man Schulkamarad’n und iehnan Kinern. Da Franz vo Piesenham.“ gewidmet. Hat er den Vater absichtlich übergangen? Seinen Schulkameraden nebst ihren Kindern wollte er wohl zeigen, dass aus ihm doch etwas geworden war.
Dieses Erstlingswerk leitet er sowohl mit einem „Voword“, das in Mundart geschrieben ist, als auch mit einer „Vorrede, (die gelesen werden muß)“ ein. Im „Voword“ weist er in einem Gleichnis auf sein verträumtes, nie zielgerichtetes Wesen hin, das sich in seinen Gedichten wiederfindet. Die „Vorrede“ enthält unter anderem Bemerkungen über die Schreibweise und die Aussprache der Mundart.
Die Aussprache ist natürlich von der Herkunft eines Vorlesers abhängig; was das kindliche Ohr nicht erfasst hat, kann später nicht mit dem wahren Zungenschlag vorgetragen werden. Aber man liest ja meist nur für sich, da kann die Richtigkeit der Lautung ohnehin niemand überprüfen. Anders stehen die Dinge bei der Schreibung, die hat dem Lesenden zu dienen und soll daher das Wort auf einen Blick erkennbar machen. Stelzhamer schreibt u.a.:
„Das Buch, wie schon sein Titel aussagt, ist im ob der Enns’schen Volksdialekte geschrieben. In der Schreibweise (Orthographie) wollte ich im Allgemeinen lieber dem älteren P. Maur. Lindermaier* als den jüngeren Dichtern unter der Enns folgen; mußte aber auch von diesem wieder in manchen Stücken abweichen, um meinem Grundsatze – überall möglichst das gute Wort herausblicken zu lassen, treu zu bleiben. …
Nun sehen sie, unser Volksdialect hat noch häufig den altgermanischen Urklang in den Vocalausgängen, z.B. Vadá, Muedá etc. etc.; eine fast Überweichheit, indem sie die harten Consonanten eigentlich gar nicht kennt; und eine bewunderungswürdige Euphonie, die sie durch Wegnahme und Einstreuung von Liquiden bewirkt, z.B. Bo dir, bon enk (Bo – bei) won i oder wor i (wo ich) u. dgl.“
Im weiteren Verlauf gibt Stelzhamer noch mehr Erklärungen zu seiner Schreibung ab.
Ein kurzes, eher selten vorgetragenes Gedicht aus seinem ersten Gedichtband soll diese Folge beschließen.
Dö Blüeml.
Dö Blüemel, i sag enks,
Sán dnettá wie d’Leut,
Und sö bußeln sö d’Wángerl
A z’eftás voll Freud.
Weil s’awá kain Ármerl,
Kain Hánderl nöt ham;
So boigt iehn dá Zugwind
Dö Köpferl oft zsam.
Drum Schatzerl, so gib má –
Los’, herst nöt án Wind?
Jetzt bußeln sö d’Blüemel –
A Bußerl gschwind gschwind!
-
Folge 11, erschienen in der Stelzhamerbund-Zeitschrift wortgarten, Oktober 2012:
Franz Stelzhamers Weg zum freien, wenngleich ein Leben lang darbenden Schriftsteller und Vortragenden in eigener Sache begann nach seinem missglückten Versuch, ein Schauspieler zu sein. In seiner Innviertler Mundart zu dichten hatte er schon während des Theologiestudiums in Linz begonnen. Er hatte wohl eine erkleckliche Anzahl von Gedichten dieses Genres bei sich; auf seinen Wanderungen gingen ihm sicherlich genug Erlebnisse und Gefühle durch den Kopf, die er in seiner gefühlvollen, trefflichen Art zu Papier brachte. In Neuhaus am Inn, das in seiner Kurzdarstellung neben Schärding nicht gut weg kam, hielt er seine erste Lesung. Die Aufnahme war mäßig, trotzdem wurde eine zweite Lesung angesetzt, bei der um Subskribenten für die Drucklegung seiner Gedichte geworben wurde.
 Der Weg nach Reichersberg (Foto: Forstinger) war nicht sehr weit, und Stelzhamer besuchte dort seinen Seminarkollegen Eduard Zöhrer, der im Stift als Chorherr wirkte. Der musikalisch begabte Freund hatte schon mehrere Gedichte Stelzhamers vertont, so war er im Kloster kein Unbekannter und wurde herzlich empfangen.
Der Weg nach Reichersberg (Foto: Forstinger) war nicht sehr weit, und Stelzhamer besuchte dort seinen Seminarkollegen Eduard Zöhrer, der im Stift als Chorherr wirkte. Der musikalisch begabte Freund hatte schon mehrere Gedichte Stelzhamers vertont, so war er im Kloster kein Unbekannter und wurde herzlich empfangen.
Die Lesung, die er dort hielt, fand freudige Aufnahme, und die anwesenden Chorherren zeichneten 24 Silbergulden an Pränumeration auf seinen zu druckenden „Erstling“.
Jetzt hatte Stelzhamer also ein beträchtliches „Vermögen“ in Händen – es sollte aufwärts gehen! Aber ach, Stelzhamer und das liebe Geld vertrugen sich halt nicht. Zuerst fing alles prächtig an. Prälat Straub ließ den hoffnungsvollen Dichter mit dem Prälatenwagen, den ein Livrierter lenkte, nach Großpiesenham kutschieren. Das mag wohl den Bewohnern des kleinen Ortes mächtig imponiert haben, doch der Vater blieb bei dem strengen Nein zum Wunsch des Sohnes, sein Domizil in seinem Haus aufzuschlagen. Er kannte seinen Franz zur Genüge. Stelzhamer ging in der Folge nach Aurolzmünster, kehrte dort in einer Gastwirtschaft ein und verspielte prompt sein ganzes Geld beim Kegelscheiben an den örtlichen Metzger.
Er wäre kein Dichter gewesen, wenn ihn dieses fatale Ereignis nicht zu einem Werk angeregt hätte. Allerdings geht es im Gedicht „Dá Spiellump“, wie er es nannte, um einen dem Kartenspiel Verfallenen, wobei schlussendlich das Sprichwort „Der Weg zur Hölle ist mit guten Vorsätzen gepflastert“ Gültigkeit bekommt. Schon in seiner Salzburger Gymnasialzeit hatte man ihn beim Kartenspiel in Wirthäusern angetroffen. Bei seinen Lehrern war er deshalb in Ungnade gefallen.
Dieses Gedicht „Dá Spiellump“ beschreibt er das Auf und Ab zwischen Hoffnung und Enttäuschung. Es erschien 1844 in Wien bei Peter Rohrmann, k. k. Hofbuchhändler, in einer zweiten, vermehrten Ausgabe unter dem Titel „Lieder in obderenns’scher Volksmundart“, in der ersten Auflage von 1837 fehlt es noch.
–
Folge 10, erschienen in der Stelzhamerbund-Zeitschrift wortgarten, Juli 2012:
Sorgenschwer wird der Heimweg aus Passau für Frau Stelzhamer gewesen sein. Der weitere Lebensweg ihres geliebten Sohnes wird ihr wohl oft und oft durch den Kopf gegangen sein. Und Franz stand in Schärding und wusste wohl auch nicht so recht, was er anfangen sollte. Doch er war jung und daher gegenüber der Ungewissheit seiner Zukunft sicher unbeschwert eingestellt.
*
Schärding, die barocke Stadt am Inn, um etwas abzuschweifen, kommt in Werken Stelzhamers mehrmals vor. In „Neue Gedichte in obderenns’scher Volksmundart“, 1846 bei Manz in Regensburg erschienen, beschreibt er unter „Sagt a, sagt a“ viele der von ihm besuchten Gegenden und Städte als „Gemütliche Reise durch Oberösterreich und Baiern“. Schärding und Braunau werden so bedacht:
Die Gränzstädte Schärding und Braunau
Wer noch liebt – hofft und glaubt –
Dem wirds hier – am ersten graubt: -
Schundi diesseits – schofel jenseits –
So a Löbn – wen erfreuts!
Doch wer hier diesseits – nicht ist glücklich –
Kann ins Jenseits – augenblicklich –
Das ist fein – das ist schlau –
O Stadt Schärding – o Braunau! –
Jedoch ich lob mir – den Vater Inn –
Der rauscht lustig – zwischen drin.
In seinem Hexameter-Epos „Soldatenvöda“ lässt Stelzhamer seinen Großonkel Martin, der sich bei den bayerischen Dragonern verdingt hatte, desertieren. Mit seiner von zu Hause durchgebrannten Braut Agnes vor sich im Sattel, galoppierte er bei Nacht und Nebel in Schärding über die Innbrücke. Bei den „Kaiserlichen“ in Österreich, das ja seit 1779 bis zum Inn reichte, setzte er seine Soldatenlaufbahn fort. Alt geworden, verbrachte er seine Tage in Großpiesenham.
Stelzhamer, der diesen Großonkel als kleiner Bub noch erlebt hat, beschreibt dessen Leben nach der Darstellung seines Ähnls, die der bei der Totenzehrung nach dem Ablebens des „Soldatenvödas“ kundtut. Die Flucht* der beiden Verliebten schildert Stelzhamer so:
Soat ava: Weibsbild, woaßt was, wannst mi gern hast und liabst mi von Herzen,
Pack dein böst’s Sacherl gschwind zsamm; denn heunt bo da Nacht gehn ma hohlaus.
…
Und aft Vöda, schau hi, schau siagst, wiar a Reida dahersprengt!
Manschein, schein! Manschein, schein! Daß s‘ ananda dablickan und kennan!
Siagst, wia si ‘s Roß bamt – ha, Rappl, ha! – und siagst as, wie s‘ glangan!
Hupps! – Had ‘s schan obn, und fluggs wia da Sturmwind saust ‘s iazt von danna!
Und du Rößl laf, laf; denn sinsten is ‘s gschehar um all droi! –
Wia sö dö Bruck schwuimt, hert ’s, und wia ‘s kracht – bum! iazat ham s‘ gschossen –
Leicht s‘ ‘n gen troffen ham? – Nan! ma herts nu sprengar und welteln –.
Eine großartige Dichtung! Und was mir bei Stelzhamer so wertvoll ist – immer schildert er den Alltag seiner Zeit, das Verhalten der Leute und die kleinen Normen des Alltags bei verschiedenen Anlässen. So wie eben beim „Soldatenvöda“ in der Wirtshausszene oder beim Begräbnis und der Zehrung.
 *) Eine dramatische Darstellung dieser Flucht, im Hintergrund das Kloster Vornbach in Bayern, zeigt diese Zeichnung des akademischen Malers Alois Greil (1841-1902): aus „Franz Stelzhamers mundartliche Dichtung“, bearbeitet von Norbert Hanrieder und Georg Weitzenböck, Reihe „Aus der Hoamat“ – Band 7, Linz 1897.
*) Eine dramatische Darstellung dieser Flucht, im Hintergrund das Kloster Vornbach in Bayern, zeigt diese Zeichnung des akademischen Malers Alois Greil (1841-1902): aus „Franz Stelzhamers mundartliche Dichtung“, bearbeitet von Norbert Hanrieder und Georg Weitzenböck, Reihe „Aus der Hoamat“ – Band 7, Linz 1897.
-*
 Noch einmal Schärding und Stelzhamer. Diesmal stehen sie (posthum) in Zusammenhang mit einem seiner größten Verehrer und Bewahrer seines Andenkens, Dr. Hans Zötl. Ohne ihn gäbe es den Stelzhamerbund nicht, auch nicht das Vadernhaus in Großpiesenham, die Landeshymne und die Buchreihe „Aus da Hoamat“, um das Wichtigste aufzuzählen. Die Gedenktafel, die seit 1966 sein Geburtshaus in Schärding, Innbruckstraße Nr. 17 ziert, lässt ihn nicht vergessen sein.
Noch einmal Schärding und Stelzhamer. Diesmal stehen sie (posthum) in Zusammenhang mit einem seiner größten Verehrer und Bewahrer seines Andenkens, Dr. Hans Zötl. Ohne ihn gäbe es den Stelzhamerbund nicht, auch nicht das Vadernhaus in Großpiesenham, die Landeshymne und die Buchreihe „Aus da Hoamat“, um das Wichtigste aufzuzählen. Die Gedenktafel, die seit 1966 sein Geburtshaus in Schärding, Innbruckstraße Nr. 17 ziert, lässt ihn nicht vergessen sein.
Folge 9, erschienen in der Stelzhamerbund-Zeitschrift wortgarten, April 2012:
Es war das Jahr 1833, Franz Stelzhamer war also 31 Jahre alt, als der Versuch, Priester zu werden, endete. Vergeblich hatte er Freunde und Bekannte angepumpt, die konnten oder wollten aber nicht helfen. Nach kurzem Aufenthalt bei den Eltern, der Vater wollte den unsteten, ziellosen Franz nicht im Haus haben, ging dieser nach Salzburg. Zur Jahreswende 1834/35 erkrankte er dort und wanderte dann, nachdem er genesen war, zu Fuß (!) über Passau und Regensburg nach München.
Trotz seiner misslichen Lage war er nicht bereit, einen Brotberuf zu ergreifen. Er hatte ja ständig schriftstellerisch gearbeitet und daher sicherlich genug Material zur Veröffentlichung in Händen. Der aus Ried im Innkreis stammende Ministerpräsident von der Pfordten wirkte in München und sollte, als Landsmann sozusagen, bei der Suche nach einem Verleger helfen. Es schwebte ihm auch vor, ähnlich wie Raimund und Nestroy, in selbst verfassten Theaterstücken auf der Bühne zu stehen. Hans Commenda erwähnt in seiner Stelzhamer-Biografie, dass schon in München Schuldhaft über unseren Akteur verhängt wurde, aus der ihn Oheim Jakob und Muhme Korona auslösten.
Auf dem Rückweg nach Österreich bot sich ihm in Passau endlich die Möglichkeit, als Schauspieler ein kleines Engagement zu erhalten. Im Königlichen Theater war durch einen Ausfall eine Rolle frei geworden, für die er einspringen konnte. Leider kam das Theater in finanzielle Schieflage und musste geschlossen werden, jedenfalls vorübergehend. Gage gab es daher keine. Stelzhamer schildert diese Situation einem Bekannten aus seiner Wiener Zeit, Ludwig August Frankl1: „Aber die elende Gesellschaft ging schmählich zugrunde und ich bekam die halbjährige Gage nicht. Ich war 9 fl2 für Miete schulding. Da schrieb ich den Eltern. `Schuldig bleiben darf der Franz nicht!´, sagte der Vater, gab der Mutter 9 fl und die Mutter kam zu Fuß nach Passau und brachte mir das Geld. Mitnehmen durfte sie mich nicht.“
 Dieser Fußmarsch ist legendär geworden in der Lebensbeschreibung des Franz Stelzhamer, ihm verdankt er vielleicht die Entstehung seines wohl bekanntesten Gedichtes „Mein Müaderl“. Sehen wir uns dieses Ereignis etwas genauer an. Die Strecke Großpiesenham – Passau beträgt etwa 60 Kilometer (Kartenausschnitt aus einem Atlas der Zeit, ANDREES 1893), wofür Frau Stelzhamer bei zügiger Gehweise, die war damals ja Gewohnheit, etwa 12 Stunden benötigt haben wird. Das war für eine sechzigjährige Frau eine Herausforderung. Vielleicht hat sie dann und wann einmal ein Fuhrwerk ein Stück mitgenommen, wir wissen es nicht.
Dieser Fußmarsch ist legendär geworden in der Lebensbeschreibung des Franz Stelzhamer, ihm verdankt er vielleicht die Entstehung seines wohl bekanntesten Gedichtes „Mein Müaderl“. Sehen wir uns dieses Ereignis etwas genauer an. Die Strecke Großpiesenham – Passau beträgt etwa 60 Kilometer (Kartenausschnitt aus einem Atlas der Zeit, ANDREES 1893), wofür Frau Stelzhamer bei zügiger Gehweise, die war damals ja Gewohnheit, etwa 12 Stunden benötigt haben wird. Das war für eine sechzigjährige Frau eine Herausforderung. Vielleicht hat sie dann und wann einmal ein Fuhrwerk ein Stück mitgenommen, wir wissen es nicht.
Es soll die Mutterliebe nicht in Abrede gestellt werden, aber aus obigem Zitat geht hervor, dass der Vater mit der ehrenrettenden Aufforderung „schuldig bleiben darf der Franz nicht!“ sehr wohl der Auslöser gewesen sein mag. Vielleicht hätte ihn die Mutter ganz gerne einmal etwas „dünsten“ lassen, denn er hatte ihr ja im Laufe der Jahre schon genug Sorgen gemacht. Wie auch immer – nach Begleichung seine Schulden machten sie sich dann gemeinsam auf den Weg ins Innviertel.
 Ein Gemälde von Anton Greil3 (links) zeigt in einer romantisierenden Darstellung die beiden auf dem Heimweg auf der Höhe von Maria Hilf; im Hintergrund ist die Stadt Passau zu sehen.
Ein Gemälde von Anton Greil3 (links) zeigt in einer romantisierenden Darstellung die beiden auf dem Heimweg auf der Höhe von Maria Hilf; im Hintergrund ist die Stadt Passau zu sehen.
Dieses Gemälde diente dem Alois Forstmoser4 als Vorlage für eine Zeichnung, die in „Aus da Hoamat“ (Bd. 31) wiedergegeben ist:  Darauf ist auch noch die „Frau Not“ Begleiterin im Hintergrund (Bild rechts).
Darauf ist auch noch die „Frau Not“ Begleiterin im Hintergrund (Bild rechts).
Gemäß dem Befehl des Vaters durfte Franz nicht nach Hause kommen. So trennten sie sich in Schärding.
____________________
1) Ludwig August Frankl von Hochwart, Arzt und Schriftsteller (3.2.1810 – 12.3.1884)
2 ) fl steht für Florin = Gulden; grob geschätzt waren 9 fl der Gegenwert für einen Arbeitslohn von 3 Wochen
3) aus Tirol stammender Genremaler (27.3.1841 – 12.10.1902)
4) akad. Maler, lebte in Uttendorf (1866 – 1905)
.
.
Folge 8, erschienen in der Stelzhamerbund-Zeitschrift wortgarten, Jänner 2012:
Es war also kein Geld von Antonia zu erwarten. Das Studium hatte er abgebrochen. Was er vorzuweisen hatte, war eine verbriefte Befähigung, als Hauslehrer zu agieren. Das war aber sicherlich nicht das, was seinen Neigungen entsprach. 1828 war er in dieser Funktion bei einem Apotheker in Wien. 1829/30 bekam er eine Stelle als Nachhilfelehrer bei der Familie eines Postmeisters in Bielitz in Schlesien, das heute zu Polen gehört. Doch das waren nur kurze Episoden im Leben Stelzhamers, die nicht lange währten. Zurück in Wien, verkehrte er in Künstlerkreisen, hielt sich mit kleinen Beiträgen in Zeitungen so recht und schlecht über Wasser. In Wien studierte auch Sylvester Wagner, ein ehemaliger Schulkollege aus Salzburg. Auch der ein armer Student, wurde von einer Bürgerfamilie öfters zum Nachtmahl eingeladen. Die Reste des Essens durfte er mitnehmen, die er dann mit Stelzhamer teilte. Ein untragbarer Zustand! Zu dieser Zeit dichtete er:
Die Armut wuchs so groß,
Daß mir vom alten Rock
Die Knöpf’ und Heften reißen los,
Daß Knauf und Stachel an dem Stock
Dem Schacherjuden ward zutheil -
Und selbst der Prügel wär’ mir feil.
 Dieses Gedicht, das eine fast dramatische Situation schildert, habe ich in einem Lebensabriss Franz Stelzhamers zitiert, veröffentlicht im Jahresbericht 2001/2002 des Bundesgymnasiums Ried im Innkreis.
Dieses Gedicht, das eine fast dramatische Situation schildert, habe ich in einem Lebensabriss Franz Stelzhamers zitiert, veröffentlicht im Jahresbericht 2001/2002 des Bundesgymnasiums Ried im Innkreis.
In dieser verzweifelten Situation entschloss er sich, dem Wunsch der Eltern folgend, zum Theologiestudium. Konnte das gutgehen? Nein, nach zehn Monaten war es Vergangenheit. Im Gedicht „Der Externist“ schreibt er:
Sitze ich in meiner Collegen Reih’n,
So ist mir, ich sollte nicht drunter sein;
Ich bin nicht zu gut, ich bin nicht zu schlecht,
Nur eben nur ganz und gar nicht recht!
Daran war die „holde Weiblichkeit“ schuld, die sicherlich in konkreter Person vorhanden war. Hans Commenda führt in seiner Stelzhamerbiografie „Franz Stelzhamer – Leben und Werk“ (1953, OÖ. Landesverlag) das Gedicht „Noviz-Lied“ an, das deutlich macht, wie sehr Stelzhamer „gekämpft“ hat:
Macht mir die Augen blind und reißt mir geschwind
Das Herz und den Arm aus dem Leib;
Sonst kann ich das liebliche Weib nicht hassen, nicht lassen;
Muß folgen mit sonnigen Blicken der Wonnigen –
Muß, muß sie umfassen!
Eine unangekündigte Prüfung brachte das Ende für die angestrebte Theologenlaufbahn. „Sie scheinen nicht studiert zu haben“, warf ihm der Professor vor. Darauf Stelzhamer: „Wenn ich nichts studiert habe, so bin ich hier überflüssig.“ Er verneigte sich und ging.
Aus dieser Zeit sind lose Tagebuchblätter erhalten, die den von sich eingenommenen Menschen erkennen lassen, der sich ganz und gar zum Künstler und Schriftsteller berufen fühlt. Wir lesen:
„Ich bin Poet und will es bleiben immerdar! Will mutig und unverdrossen hinwandeln durch den düstren Wald der drohenden Gesichter, über die Klippen und Abgründe der Mißgunst, unter den grauen Nebeln des Ingrimms; rasch vorbei an den Lockungen des bürgerlichen Glücks, hindurch durch das Gesurm und Gesäuse der Ähnlichen bis hin an den strahlenden Fels des Nachruhms – auf seinen Höhen zerschlage ich mein morsches Gebein und wirf es zurück auf die mütterliche Erde – und – das weitere tut Gott!“
Mit dieser visionären Lebensplanung Franz Stelzhamers will ich heute meinen Bücherschrank schließen.
.
Folge 7, erschienen in der Stelzhamerbund-Zeitschrift wortgarten, Oktober 2011:
Antonia Nicoladoni, die früh Verwitwete, Stelzhamers Toni-Tora, hatte also wieder Kontakt mit dem einstigen Backfischschwarm Franz. Sie musste aber erkennen, dass der gute Franz Stelzhamer zwar ein liebenswürdiger, intellektueller Feuerkopf war, den Alltagspflichten aber ziemlich untauglich gegenüberstand. Das befremdete sie sicherlich, denn ihre Welt war vor und in der verflossenen Ehe das gesicherte Bürgertum. Stelzhamer, der inzwischen in Wien sein Jurastudium fortzusetzen versuchte, anfangs auch mit gutem Erfolg, litt ständig unter Geldnot. Geld hatte bei ihm eine kurze Verweildauer. Da war es nicht verwunderlich, dass auch Antonia von ihm um finanzielle Unterstützung gebeten, man könnte auch sagen angegangen, wurde. Aber die jugendliche Witwe Antonia Wittmann war diesen Bitten gegenüber taub. Lesen wir dazu in der Stelzhamerbiografie von Franz Braumann, „Franz Stelzhamer – Leben und Dichtung“ (OÖ. Landesverlag, 2. Auflage 1974):
Auch von seiner geliebten Toni in Salzburg kam keine Hilfe, als er sie mehrmals um Geld anflehte. Seine Enttäuschung darüber ließ auch das Liebesfeuer erkalten. In einem späteren Brief an sie schreibt er: „…mit nächster Post Hilfe, oder kein Wort mehr von dir!“
Somit bestand vorerst kein Kontakt mehr zwischen den beiden. Antonia heiratete in der Folge wieder, Franz ging seinen gewundenen, von ständiger Geldnot gezeichneten Lebensweg weiter. Als er Jahre später selbst Witwer geworden war und seinen Wohnsitz in Salzburg aufgeschlagen hatte, bahnten sich wieder Kontakte mit der Familie von Antonia an. Sie war die Frau des Domorganisten Tremml und mehrfache Mutter geworden. Während dieser Besuche bei der Familie Tremml verliebte sich die älteste Tochter von Antonia, Hermine, in den vierundfünfzigjährigen Stelzhamer. Als die Mutter merkte, was sich anbahnte, wies sie Franz aus dem Haus. Doch die schwärmerische Hermine suchte die Nähe von Stelzhamer und der wehrte sie nicht ab. Es kam zu intimen Kontakten, die in einer Totgeburt endeten. Vielleicht hat der verletzte Stolz Stelzhamers, von dem man bei seinem Alter mehr Beherrschung voraussetzen hätte dürfen, diese Verbindung gefördert. Es gibt ein Gedicht in seinem Lyrikband „Liebesgürtel“, das in dieser Hinsicht diese Vermutung zulässt.
Im Vorwort zum erwähnten Buch „Liebesgürtel“ schreibt 1875 Herausgeber Dr. Egger-Möllwald*: „Mit schuldiger Pietät gegen den Genius des Dichters habe ich versucht, aus dem bereits gedruckten und dem handschriftlichen Materiale eine einheitliche Sammlung herzustellen, welche geeignet wäre, den oberösterreichischen Poeten dem Herzen des gesammten deutschen Publikums näher zu bringen.“
Ich denke, dieses kompromittierende Gedicht hätte unveröffentlicht im Nachlass verbleiben sollen.
*) Dr. Friedrich Ritter v. Egger-Möllwald, Kustos der k. k. Hofbibliothek in Wien
.
Folge 6, erschienen in der Stelzhamerbund-Zeitschrift wortgarten, Juli 2011:
Hoffnungsloses Verliebtsein kann einem empfindsamen Menschen schwer zusetzen und ihn aus der Bahn werfen. Mancher Suizid geht darauf zurück – und kann von abgeklärten Älteren nicht (mehr) verstanden werden. Nein, Selbstmord beging er nicht, der Franz Stelzhamer. Aber gelitten hat er sehr, das beweisen seine Gedichte. Hier eine Probe aus seinem Band „Liebesgürtel“, der seine hochdeutschen Gedichte enthält und 1876, also posthum, im Verlag von Gustav Heckenast, Preßburg und Leipzig, erschienen ist.
Ich habe keine Rast und keine Ruh‘
Ich habe keine Rast und keine Ruh‘,
Denn meine Rast und Ruh hast Holde Du.
Ich finde nirgends Friede, nirgends Freud’,
Allein bei Dir ist Lust und süßes Leid.
Dein Hauch, Dein Blick weckt Blumen überall,
Dein Gruß gibt tausendfachen Wiederhall.
Darum gefällt mir nichts in aller Welt,
Wo Du nicht bist, weil stets das Schönste fehlt.
Allein bei Dir, mein Lieb, bei Dir allein,
Sonst lieber tot oder ungeboren sein!
Zeit heilt bekanntlich Wunden, auch die, die unglückliche Liebe schlägt. Nach seinem schulischen Abschluss in Salzburg ging Franz Stelzhamer zum Studium der Rechtskunde nach Graz, dort lebte ja sein Bruder Peter. Der Hallodri, der im jungen Stelzhamer steckte, war diesem Studium nicht förderlich. Lesen wir bei Hans Commenda, in „Franz Stelzhamer – Leben und Werk“, OÖ Landesverlag, 1953:
„Zum Liebesschmerz um Antonie gesellte sich bald drückende Geldnot. Als richtiger Bruder Leichtsinn nahm Stelzhamer solche Bürde anfänglich zwar auf die leichte Achsel: ‚Zu Kummer und Sorgen sag ich voll Güte heut: Ei, komm doch morgen, heut hab ich keine Zeit!‘“
Inzwischen war „seine“ Toni-Tora eine ganz junge Witwe geworden. Commenda schreibt:
„Zu solchen Daseins- und Studiensorgen traten nun neue Herzensnöte. … Somit war Toni, die erste und heißeste Liebe Stelzhamers, wieder frei geworden. Nach anfänglichem Widerstreben nahm Franz die seit sieben Jahren erkalteten Beziehungen zu seiner Tora wieder auf und war ihr bald neuerlich mit Leib und Seele verfallen.“
Josef Karl Dittrich beschreibt in seinem Stelzhamer-Lebensroman „Toni-Tora“, der 1931 im Verlag „Das Bergland-Buch“, Graz erschien, in einer wohl zu phantasievollen Form das erste Wiedersehen. Nach einem fiktiven, zufälligen Zusammentreffen der beiden in Salzburg lässt er das Geschehen so ablaufen:
„Toni fühlte die Hilflosigkeit, die Scham ihres Freundes und ging über alles hinweg, tat, als säße er blühend in Galakleidern an ihrer Seite. Sie fühlte nur Mitleid mit ihm und große Zufriedenheit, ihn wieder zu haben. Diese innere Lust flackerte in den Augen, dazu wurde der Kobold in ihr wieder wach. Sie schielte hinüber zu ihm und fragte: ‚Bist du mir böse, daß ich dich nicht hab ausreißen lassen, du Schlimmer?‘ Als er keine Antwort gab, bat sie: ‚Bitte Franzl, deine Hand reich mir herüber. Wenn du mich auch sonst nicht leiden kannst, deine Hand nur, die kannst du mir schon geben.‘ In Franzl spukte Liebe und Scham ärgerlich durcheinander. Reichte schließlich doch die Hand hinüber, die sie begierig ergriff.“
Es wird wohl nicht so theatralisch stattgefunden haben, dieses erste Wiedersehen. Mit Sicherheit war diese Antonia nicht mehr der verliebte Backfisch von einst, sondern lebenserfahren, trotz ihrer Jugend.
.
Folge 5, erschienen in der Stelzhamerbund-Zeitschrift wortgarten, April 2011:
Da war es also auch über Franz Stelzhamer gekommen, dieses unerklärliche Gefühl, das man Liebe nennt, für das es keine wissenschaftliche Erklärung gibt und das letztlich ein Produkt des Zufalls ist. Hätte Stelzhamer in Linz das Gymnasium besucht, hätte er sich eben dort verliebt. Und wie sehr er sich verliebte, das durchzieht sein dichterisches Werk an vielen Stellen. Leider war die Angebetete aus gutbürgerlichem Stand, was natürlich ein Problem darstellte – er war nicht ebenbürtig. Antonia Nicoladoni hieß das junge Fräulein, das ihm nicht aus seinem jugendlichen Kopf gehen wollte und das sehr wohl auch Gefühle für Franz empfand, die, darf man annehmen, auch für Antonia Neuland waren.
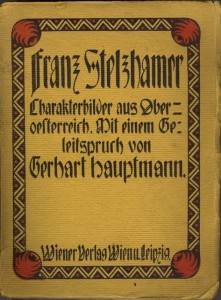 Von neugierig-empfindsamem Hingezogensein zur „Weiblichkeit“ lesen wir auch in seiner Schilderung „Groß-Piesenham“. Die findet sich unter anderem im 1906 von Max Burckhard im „Wiener Verlag“ herausgegebenen Buch „Franz Stelzhamer – Charakterbilder aus Oberösterreich“, das mit einem Geleitspruch von Gerhard Hauptmann eingeleitet wird. Als heranwachsender Jugendlicher kommt Franz nach Großpiesenham und trifft einen ehemaligen Schulkameraden. Abends durch das Dorf schlendernd, treffen sie eine Gruppe gleichaltriger Mädchen. Nach anfänglichem Geplänkel wandern sie gemeinsam weiter, wobei zwischen Franz und der ehemaligen Mitschülerin Anna Zweimüller, inzwischen eine schwarzäugige Lieblichkeit geworden, zarte Gefühle wach werden. Er schreibt:
Von neugierig-empfindsamem Hingezogensein zur „Weiblichkeit“ lesen wir auch in seiner Schilderung „Groß-Piesenham“. Die findet sich unter anderem im 1906 von Max Burckhard im „Wiener Verlag“ herausgegebenen Buch „Franz Stelzhamer – Charakterbilder aus Oberösterreich“, das mit einem Geleitspruch von Gerhard Hauptmann eingeleitet wird. Als heranwachsender Jugendlicher kommt Franz nach Großpiesenham und trifft einen ehemaligen Schulkameraden. Abends durch das Dorf schlendernd, treffen sie eine Gruppe gleichaltriger Mädchen. Nach anfänglichem Geplänkel wandern sie gemeinsam weiter, wobei zwischen Franz und der ehemaligen Mitschülerin Anna Zweimüller, inzwischen eine schwarzäugige Lieblichkeit geworden, zarte Gefühle wach werden. Er schreibt:
„Aber sonderbar! Anna, die frommstille Anna, zog ihre Hand nicht wieder an sich, sie ließ sie im Gegenteil, als hätte sie darauf vergessen, in der meinigen liegen und so schlenderten wir selbander hinein ins wogende Meer des ausgegossenen Mondlichtes.“
Das Abschiednehmen wurde dann leider durch einen Schabernack ihrer früheren Begleiter jeder Romantik beraubt und auch gehörig gestört. Wir lesen:
„So standen wir an der Ecke des Stadels noch eine geraume Weile, da – jetzt wußt‘ ich es deutlich, weiß es auch jetzt noch – Anna hatte ihre Hand auf meine Schulter gelegt, ihre schwarzen Augen hatten sich vom Mondlicht ganz vollgeschöpft und glänzten wunderbar – … da – kicherte es von der unteren Ecke des Stadels herauf – Annas Hand zuckte weg von meinen Schultern … . „Zu spät!“ seufzte Anna – es war ein gar wehmütiger Ton.“
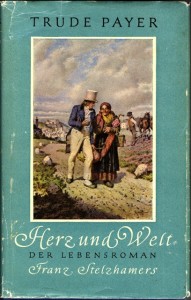 Zurück zu Antonia, von Stelzhamer „Toni Tora“ genannt. Die oberösterreichische Schriftstellerin und Malerin Trude Payer (1901-1963) hat im Roman „Herz und Welt“, in dem sie das Leben Franz Stelzhamers schildert, natürlich auch die junge Liebe zwischen Franz und Antonia aufgegriffen. Den störenden Einfluss der erziehenden Tante schildert sie so:
Zurück zu Antonia, von Stelzhamer „Toni Tora“ genannt. Die oberösterreichische Schriftstellerin und Malerin Trude Payer (1901-1963) hat im Roman „Herz und Welt“, in dem sie das Leben Franz Stelzhamers schildert, natürlich auch die junge Liebe zwischen Franz und Antonia aufgegriffen. Den störenden Einfluss der erziehenden Tante schildert sie so:
„Was für eine barbarische Sprache der Bursche spricht, rügte sie, als Franz am ersten Abend gegangen war. „Oh, mir gefällt sein Dialekt! Er klingt so urwüchsig, riecht förmlich nach Landschaft, nach Blumen und Wald!“ wandte Toni ein. – Zum Schluß gewöhnst du dir auch noch so eine bäuerische Art zu sprechen an!“
Mag sein, dass es tatsächlich ein ähnliches Gespräch zwischen den beiden gab. Erwiesen ist, dass die Tante ihre Nichte dadurch aus dem Einflussbereich von Franz Stelzhamer brachte, indem sie Antonia den „Englischen Fräulein“ des Klosterpensionats St. Zeno bei Reichenhall zur Erziehung anvertraute. Das Mädchen sollte standesgemäß heranwachsen. Aber „Toni Tora“ sollte nicht für immer aus dem Leben Franz Stelzhamers verschwinden, sein Werk beweist es!
.
Folge 4, erschienen in der Stelzhamerbund-Zeitschrift wortgarten, Jänner 2011:
Mit dem Eintritt ins Gymnasium in Salzburg begann für Franz Stelzhamer im Oktober 1815 ein entscheidender Lebensabschnitt. Zusammen mit seinem Bruder Peter wohnte er in der Steingasse* 26, im 3. Stock beim Weißgerber Pichler, in einem engen Gässchen zwischen Kapuzinerberg und Salzach, also fast im Zentrum. Im Gegensatz zu seinem Bruder war Franz bald eine schulische Leuchte. Ein verständnisvoller Lehrer, der Weltpriester Martin Süß, erkannte die Begabungen des Schülers Franz Stelzhamer und förderte ihn nach Gebühr. In einem Brief an diesen Professor schrieb er nach 20 Jahren: „…hatte ich das Glück, des besten und geliebtesten Professors Wohlwollen zu gewinnen; in gleicher Freudigkeit erwachte Fleiß und Talent…“.
Damals war die Sitzordnung in den Klassen nach Können ausgerichtet; bald saß der Franz am Ehrenplatz, also am Ecksitz. Nach Ende des ersten Schuljahres, am 21.8.1816, wurde eine öffentliche Zensurverlesung abgehalten. Über Franz Stelzhamer lautete sie so: „Dieser Knabe ist nicht nur eine Zierde seiner Klasse, sondern er möge der ganzen anwesenden Jugend als Muster der Nacheiferung dienen! …“ Im gedruckten lateinischen Jahresbericht hieß es dann: „Praemio donati sunt: locus ex profectu per annum: I. Franciscus Stelzhamer, Schildorn, Austriacus.“ Mit einer solchen Auszeichnung war das Heimwandern ein Leichtes. Nach kurzer Zeit der Erholung daheim, machten sich Franz und Peter auf zum „Viatizieren“. Das war eine größere Wanderung durch die Lande, bei der man sich als „Student“ mit gutem Zeugnis vorwiegend bei Pfarreien und in Klöstern durchschlug. In München trennte sich Franz von Peter, da dieser aus der Wanderung eine Bettelreise machte, er aber Kenntnisse und Eindrücke sammeln wollte. Besonders die Gemäldesammlungen hatten es ihm angetan.
Am Beginn des neuen Schuljahres gab es einige Veränderungen. Der Schulbetrieb war der österreichischen Praxis angepasst, das hieß: vier Klassen Unterstufe, zwei Klassen Oberstufe und zwei Philosophieklassen für zukünftige Hochschüler.
 Die Salzburger Adresse der Brüder Stelzhamer hatte sich auch geändert, sie wohnten jetzt bei der Malerwitwe Apollinia Müller, Getreidegasse 306, 4. Stock. Die Wohnhäuser des Schülers Stelzhamer sind heute natürlich nicht gekennzeichnet – im Gegensatz zum Wohnhaus, in dem er als reifer Mann wieder einige Zeit in Salzburg lebte, in der Nähe der Müllner-Kirche, an der Müllner-Hauptstraße Nr. 17. Am Haus weist eine Tafel darauf hin.
Die Salzburger Adresse der Brüder Stelzhamer hatte sich auch geändert, sie wohnten jetzt bei der Malerwitwe Apollinia Müller, Getreidegasse 306, 4. Stock. Die Wohnhäuser des Schülers Stelzhamer sind heute natürlich nicht gekennzeichnet – im Gegensatz zum Wohnhaus, in dem er als reifer Mann wieder einige Zeit in Salzburg lebte, in der Nähe der Müllner-Kirche, an der Müllner-Hauptstraße Nr. 17. Am Haus weist eine Tafel darauf hin.
Nach dem Schuljahr 1817/18 verließ sein Bruder Peter unfreiwillig das Gymnasium in Salzburg, ging nach Graz und wurde Lottokollektant. Jetzt fehlte für Franz die Leitfigur, was sich schulisch negativ auswirkte. Außerdem wird auch die Pubertät zum Leistungsabfall beigetragen haben. Sein Leben, bisher in geregelten Bahnen, verlor sein Gleichmaß, er wechselte oft die Unterkunft. Seine schulische Verschlechterung begründet er mit einer „jähen Veränderung im Studienplane…“.
In der Oberstufe, er war jetzt 18 Jahre alt, gab es dann auch einige „Genügend“ und, vielsagend, „minder entsprechend“ im „sittlichen Betragen“! Warum das? Stelzhamer war des öfteren in Gast- und Kaffeehäusern beim Kartenspiel gesehen worden. Das Entscheidende für diese Veränderung dürfte aber die „Entdeckung der Weiblichkeit“ gewesen sein, die ihn damals und lebenslang umtrieb!
Seinem ersten, sein Leben prägenden Verliebtsein soll die Fortsetzung gelten.
 *) Steingasse: Die heutige Nr. 26 liegt außerhalb des „Inneren Steintores“, ab dort hieß es damals „Am Stein“. Durch die Gerüche der dort angesiedelten Gerbereien und wegen der Funktion als Einfallsstraße aus dem Süden galt die Steingasse als ärmlicher Bezirk. Kein Wunder, dass dort auch schon ein Bordell angesiedelt war. Der Textdichter von „Stille Nacht, Heilige Nacht“, Joseph Mohr, wuchs im Haus Steingasse Nr. 31 auf, und Heinrich Waggerl wohnte mehrere Jahre im gleichen Haus wie Franz Stelzhamer, dem heutigen „Lanz-Haus“. Fotos: Heinz Forstinger
*) Steingasse: Die heutige Nr. 26 liegt außerhalb des „Inneren Steintores“, ab dort hieß es damals „Am Stein“. Durch die Gerüche der dort angesiedelten Gerbereien und wegen der Funktion als Einfallsstraße aus dem Süden galt die Steingasse als ärmlicher Bezirk. Kein Wunder, dass dort auch schon ein Bordell angesiedelt war. Der Textdichter von „Stille Nacht, Heilige Nacht“, Joseph Mohr, wuchs im Haus Steingasse Nr. 31 auf, und Heinrich Waggerl wohnte mehrere Jahre im gleichen Haus wie Franz Stelzhamer, dem heutigen „Lanz-Haus“. Fotos: Heinz Forstinger
.
Folge 3, erschienen in der Stelzhamerbund-Zeitschrift wortgarten, Oktober 2010:
Wenn ich meinen ersten Schultag beschreiben müsste, ich würde kläglich scheitern – daran habe ich keine Erinnerung mehr. Auch viel aus meiner weiteren Schulzeit ist in der Versenkung verschwunden. Anders ist das bei Franz Stelzhamer. Der hat in seinem Buch „Die Dorfschule“, es wurde 1876 von Egger-Möllwald herausgegeben, in lebhaften Bildern dieses für ihn „gewaltige Ereignis“ geschildert.
In weiterer Folge lässt er den Leser teilhaben an seinem Schulbesuch, wobei sich vieles vom Erzählten auf dem Weg von und zur Schule abspielt. Hören wir ihm zu, wie seine Mutter, sie hatte ihn wegen seiner Zartheit ohnehin um ein Jahr zurückstellen lassen, unnachgiebig gegenüber ihrem Liebling sein musste. „Das sonst weiche Mutterherz – aus Liebe zum Kind – erhärtete, des Bübleins Tränen flossen zum erstenmal umsonst …“, so berichtet er.
Nachdem er tränenschwer das Klassenzimmer betreten hatte, wurde sein kleines Herz gleich leichter, als er von den Kindern aus seinem Dorf herzlich begrüßt wurde. Auch die Güte des Lehrers nahm ihm die erste Scheu. Stelzhamer lässt den „Fritz Blasewitz“, so nennt er sich in seiner Schilderung, als empfindsames Kind, das er wohl war, erscheinen.
Die im vorherigen Beitrag (Juli 2010) angesprochene Tierliebe klingt auch hier wieder an. Er entdeckt beim Weg zur Schule ein Vogelnest mit Nestlingen. Er schreibt darüber: „Die kleinen Vöglein aber wurden schnell größer, wurden flaumig, wurden befiedert, wurden flügge und – flogen ab. Das war dann Fritzens erster freier, sorgenloser Tag. Denn nun konnten sie die Buben nicht mehr finden und fangen.“
Eine Seite weiter heißt es: “Die Vogelnester der ganzen Gegend waren ja sein Eigentum, weil er sie alle aufgefunden hatte und bewachte.“ Vom Unterricht, den er als eifriger Schüler sehr ernst nahm, schreibt er an einer Stelle: „Heute war Landkarte. … Diese Landkarte war wieder eine wahre Fundgrube für unseren kleinen wißbegierigen Freund.“
Eine Rechtschreibübung, ein „Diktando“, wie es Stelzhamer nennt, wurde von bloß einem Schüler fehlerfrei, „sine“, verfaßt – von „Fritz Blasewitz“! Er erklärt uns diese fehlerlose Arbeit auch: „Wer Wißbegierde hat, sucht und forscht immer und überall. Der kleine Fritz hatte sie. Von jeher behorchte, besah und belauschte er alles.
Seit er nun gar lesen konnte, las er alles, Geschriebenes und Gedrucktes, was ihm in die Hände fiel.“ Heiter beschreibt er auch den neuen Kaplan, der nach Pramet versetzt worden war. Es war ein Naturmensch, der auf seine äußere Erscheinung wenig Wert legte. Seine große Leidenschaft war die Vogelstellerei. Seine Köchin war eine „Scharfe“, die ihm dieses Vergnügen, wie auch sein ungepflegtes Äußeres schnell abgewöhnte. Den kleinen Fritz schloss dieser Kaplan, weil er dessen Fähigkeiten erkannt hatte, rasch ins Herz.
Die Schulzeit war vorüber und die große Abschlussprüfung hatte „Fritz Blasewitz“ als Bester bestanden. Da stellte ihm der Vater dann die Frage, was er denn werden wolle, und nannte ihm mehrere Berufe zur Auswahl. Er sagt dann zu ihm: „Darum entschließe dich, und das bald, in den Weg gelegt wird dir wie deinen Brüdern – nichts, weder von mir noch von deiner Mutter“. Am nächsten Morgen flüsterte er seiner Mutter ins Ohr: „Studieren mag ich wie der Konrad!“ Die Mutter hinterbrachte es mittags dem Vater; dieser nachmittags dem geistlichen Herrn und – am andern Tag war Fritz Vorbereitungsstudent. Das war er beim Kaplan, der ihm bis zum Übertritt ins Gymnasium in Salzburg die ersten Schritte in der lateinischen Sprache beibrachte. Diese Salzburger Zeit soll das nächste Thema sein.
..
Folge 2, erschienen in der Stelzhamerbund-Zeitschrift wortgarten, Juli 2010:
Am 29.11.1802 hallte ein Gewehrschuss durch den kleinen Weiler Großpiesenham. Das war das Zeichen, dass dem Johann Stelzhamer, „Pfeffer“ genannt, Besitzer der kleinen Wirtschaft „Siebengütl“, ein Sohn geboren worden war. Somit begann ein Menschenkind seinen Weg durch ein Leben, das am 14.7.1874 zu Ende ging. Es war der verschlungene Weg eines Begabten, der, um seine Begabung ausleben zu können, manche Härte des Daseins in Kauf nahm. Dass er kein Angepasster war, beweisen seine Worte: „Alles lobn kann i schwerli, und das Tadeln is gefährli, in Gottsnam, gehts wies will, a Schölm ders waiß und schweigt still“.
Das hat ein reifer Mann gesagt. Bis dahin war der Weg noch weit. Das Kind wurde geliebt und wuchs behütet in der überschaubaren Dorfgemeinschaft heran. Durch die Pocken, die er im zweiten Lebensjahr nach schwerer Krankheit überlebte, wurde sein hübscher Blondkopf von zurückbleibenden Narben entstellt; ein schwerer Schlag für die sorgende, liebende Mutter. Das Aufwachsen in der freien Natur des nahen Hausruckwaldes ließ den einfühlsamen, fantasiebegabten Buben empfindsam gegen Pflanzen und Tiere werden. Später schrieb er in dem Gedicht „Drei truzigö Gsanga; 1. ‘s Roßfleisch (hier die ersten zwei von 21 Strophen):
„Fert ham s’ mi gmartert:
Sollt Thierquäler wern,
Und du mein Gott und mein Herr!
Han ´s Gviggat so gern.
Iebl is ´s nöt zun ändern,
Ma wird dazue d’neth,
Do mit Fleiß hai mei Löbta
Kain Keferl datret.
Damit würde sich Stelzhamer heutzutage wohl bei den Tierschützern einreihen! Sein schriftstellerisches Talent, seine Schreib- und Erzählgabe, wird er wahrscheinlich von seiner Mutter geerbt haben. Das Eingebettetsein in die kleine Dorfgemeinschaft schildert er in der Kurzgeschichte „Der Waldwurm“ sehr anschaulich.
In dieser Geschichte, in der eine Menge alltäglicher Gebräuche und allerlei naiver Aberglaube zur Sprache kommen, geht es darum, dass die Frauen des Dorfes mit einer großen Kinderschar zum Beerenbrocken in den Wald gehen. Er und seine Mutter sind die die Hauptpersonen der Handlung, wobei sich sein „Müadal“ beim Fangen eines Untieres (des Waldwurms) todesmutig hervortut. Das Wagnis, dieses „gräßliche“ Tier zu fangen, geht sie ein, weil ihr von einer Nachbarin erzählt wird, dass derjenige, der ein solchen Wesen mumifiziert bei sich habe, die „Preßhaftigkeit“ aller Menschen lindern und heilen könne.
 Das Büchlein erschien 1924, von Max Mell (österr. Schriftsteller, 1882 – 1971) herausgegeben, im Rikola-Verlag, Wien. Axel von Leskoschek (österr. bildender Künstler, 1889 – 1976) hat es mit Holzschnitten volkstümlich illustriert.
Das Büchlein erschien 1924, von Max Mell (österr. Schriftsteller, 1882 – 1971) herausgegeben, im Rikola-Verlag, Wien. Axel von Leskoschek (österr. bildender Künstler, 1889 – 1976) hat es mit Holzschnitten volkstümlich illustriert.
Auf dieser stimmungsvollen Schwarzweiß-Aufnahme sitzt der Autor der Serie ”Aus meinem Bücherschrank”, Heinz Forstinger, zusammen mit Mutter und Schwester etwa 150 Jahre nach der Geburt Franz Stelzhamers vorm „Vadernhaus“ in Großpiesenham:
Folge 1, erschienen in der Stelzhamerbund-Zeitschrift wortgarten, April 2010:
Der Oberste Befehlshaber der alliierten Streitkräfte in Deutschland „erlaubte“ 1948 den Druck des Schulbuches „Deutsches Lesebuch IV – Lyrik; 5. bis 8. Schuljahr. Im Vorwort steht unter anderem: „…, daß dieses Buch vom erzieherischen oder anderen Gesichtspunkten aus völlig einwandfrei ist. …und es ist zu benutzen, bis Deutschland selbst bessere Schulbücher hervorbringt“.
Dieses Buch enthält die schönsten Gedichte der deutschen Klassik und Romantik. Noch bessere Schulbücher!? Wie sollte da in Österreich anders gedacht werden; wie sollte da ein Stelzhamer noch viel in einem Schulbuch zu suchen haben. Und weil halt die oberösterreichische Landeshymne von ihm ist, wird er bei öffentlichen Anlässen noch „in den Mund genommen“. Aber sonst ist er als Schriftsteller nicht mehr präsent.
Und ein Schriftsteller wollte er sein, nicht ein Mundartdichter. Er wollte in der Schriftsprache „jemand sein“. Sein begehrtes Ziel war, dass seine Lyriksammlung „Gedichte“ bei Cotta in Stuttgart erscheinen sollte, dem Verlag, in dem auch Goethes Werke erschienen waren. Dass er seine dichterische Ausdruckskraft in der Hochsprache weit überschätzte, ist ihm wohl nicht deutlich bewusst geworden.
Es ist vielleicht unmöglich, eine besondere Ausdrucksstärke in einer Sprache zu erreichen, in die man nicht geboren wurde. Und groß geworden war Franz Stelzhamer, als Bub vom Land, in Großpiesenham bei Pramet. Und daher hat er seinen unbestreitbar hohen Intellekt am eindrucksvollsten in der Heimatsprache zur Geltung gebracht. Die ersten beiden Strophen von „Der oanschichti Mensch“ sollen das zeigen:
Mein Freundschaft is gstoribn,
Mein Feindschaft begrabn
Und die andern Leut wolln
Mit oan’ ehnter nix haben.
Mih grüaßt neamd, mi pfüat’ neamd,
Wor ich kim oder geh,
Neamd freuts’s, neamd bedauert’s,
Is ma wohl oder weh.
Zum Vergleich, aus seinem hochdeutschen Schaffen, die ersten Strophen von „Liebesstrahl“:
Eh noch der Liebesstrahl Sich in mein Herze stahl,
Durchglühte wohl mit reger Lust
Gar mancherlei die junge Brust.
So liebte ich vor allen Dingen:
In muntrer Schaar bei Becherklange
Dem Traubengotte Preis zu singen
In dithyrambischen Gesange,
Eh noch der Liebesstrahl
Sich in mein Herze stahl.
Welch ein Unterschied! Um beim „hochdeutschen“ Stelzhamer zu bleiben, sei auf sein dreibändiges Werk „Prosa“, das 1845 bei Manz in Regensburg erschienen war, hingewiesen. Der erste Band trägt den Untertitel „Mein Gedankenbuch“. Es enthält eine umfangreiche Aphorismensammlung, die seine Meinung über die Menschen und seine Lebenserfahrung widerspiegeln. Daraus ein paar Zitate:
„Das Ansprechen setzt immer in größere Unbequemlichkeit und Verlegenheit, als das Angesprochenwerden; daher suche dir’s im kleinen wie im größeren Leben so einzurichten, daß du mehr mußt angesprochen werden.“
„Samson erschlug mit dem Eselskinnbacken einst 500 Philister. Jetzt ist es umgekehrt: fast täglich ziehen 500 Philister mit ihren Eselskinnbacken gegen Einen geistigen Samson zu Felde.“
„Ich meine, wer nur die Staatskunst der Horniße, Wanderheuschrecken, Bienen, vorzüglich aber der Ameisen im Kopfe hätte, derselbe müßte die unsere bequem in den zwei kleinen Fingern bewahren.“
.
Autor Heinz Forstinger über sich selbst:
 Mitte des Zweiten Weltkrieges geboren, war meine Kindheit noch eingebettet in eine anspruchslose Welt. Das „Mitreisen“ am Ende des Wiesbaumes eines Pferdefuhrwerks war für Buben deshalb spannend, weil so mancher Kutscher das mit seiner Peitsche verhindern wollte. Barfußgehen war in den Monaten ohne „R“ Freizeit-Alltag; die blutig aufgeschlagene große Zehe schmerzhafte Folge davon. Schweineschmalz und dürftiger Verband dienten der Desinfektion und als Heilsalbe.
Mitte des Zweiten Weltkrieges geboren, war meine Kindheit noch eingebettet in eine anspruchslose Welt. Das „Mitreisen“ am Ende des Wiesbaumes eines Pferdefuhrwerks war für Buben deshalb spannend, weil so mancher Kutscher das mit seiner Peitsche verhindern wollte. Barfußgehen war in den Monaten ohne „R“ Freizeit-Alltag; die blutig aufgeschlagene große Zehe schmerzhafte Folge davon. Schweineschmalz und dürftiger Verband dienten der Desinfektion und als Heilsalbe.
Lesen war, neben den verschiedenen Kinderspielen, die ja immer im „Rudel“ stattfanden, das Futter für die Fantasie. Den Berufsalltag bis zur Pensionierung habe ich in einer Bank verbracht – pflichtbewusst. Mit vierundzwanzig Jahren heiratete ich, wissend, nach Schiller (Die Bürgschaft), dass „Treue kein leerer Wahn“ sei. Drei Kinder haben mit fünf Enkeln (bis jetzt) die Familie vergrößert.
Meine Freizeit fülle und füllte ich „randvoll“ mit Naturkunde und Lesen. Dabei hat es mir besonders Franz Stelzhamer angetan, der mehr zu bieten hat als „Müadal“, „Kerschbam“ und „Högl“.









